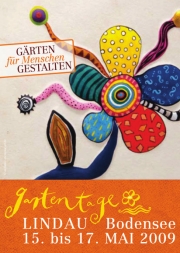tm
Dauerhafter Fruchtschmuck für draußen
Die Torfmyrte (Pernettya mucronata) erträgt Fröste bis zu –10 °C und eignet sich deshalb bestens, zwischen Heidekräutern, Gräsern und anderen frostharten Arten, für die vorweihnachtliche Bepflanzung vor der Haustüre, auf dem Balkon oder der Terrasse. Der aus Südamerika stammende Zwergstrauch trägt zugespitzte immergrüne Blättchen. Das Schaustück aber sind die dicht stehenden, glänzenden Beeren in Rosa, Rot oder Weiß. Auch wenn sie mit der Zeit etwas verschrumpeln, behalten sie über lange Zeit ihre Farbe und erfüllen daher den ganzen Winter über ihre dekorative Wirkung. Wer sie weiterkultivieren möchte, sollte sie wie eine Moorbeetpflanze behandeln und in ein kalkarmes Substrat setzen (Rhododendron-Erde). Damit sie wieder Früchte ansetzt, wäre eine zweite, männliche Pflanze erforderlich.
Wie hilft man Tieren im Garten durch den Winter?
Schnee und Frost behindern nicht nur das Leben der Pflanzen im Garten. Auch tierische Mitbewohner leiden mehr oder weniger unter den Bedingungen und reagieren dankbar auf die eine oder andere Hilfestellung.
Die Geschichte der Gartentage Lindau in Bildern - 4. Teil: 2009
Auf der Gartentage-Homepage blenden wir in Erinnerung zurück auf die vergangenen Veranstaltungen. 4. Teil: 2009
https://www.gartentage-lindau.de/die-geschichte-der-gartentage-lindau/2009.html
Rosmarin – der „Tau des Meeres“
Rosmarin (Rosmarinus officinalis), ein immergrüner Halbstrauch aus der Familie der Lippenblütler, ist ein hervorragendes Tonikum für Geist und Kreislauf, verbessert die Denkfähigkeit, stärkt und kräftigt das Hirn, durchblutet es besser und hebt Kreislauf und Blutdruck an.
Eine Kolumne von Pflanzenkundlerin Adelheid Lingg
Beerensträucher vegetativ vermehren
Vor Beginn der kalten Jahreszeit, nachdem die Blätter bereits abgeworfen sind, kann man von vielen Beerensträuchern Steckhölzer abnehmen, um sie vegetativ zu vermehren. Dazu schneidet man von den Gehölzen gut ausgereifte, ca. 20–25 cm lange Triebe. Zur Überwinterung werden sie in Bündeln in feuchtem Sand eingeschlagen und in einem kühlen, aber frostfreien Raum gelagert. Im Frühjahr lassen sie sich dann bewurzeln.
Eine andere, relativ einfache Methode zur Vermehrung der Beerensträucher erfolgt durch so genannte Absenker. Dazu werden kräftige Einjahrstriebe zum Boden geführt, mit einer Klammer befestigt und mit Erde angehäufelt, so dass sich im Laufe des nächsten Jahres dort Wurzeln bilden. Noch einfacher ist es, Triebe für die Vermehrung abzunehmen, die sich von selbst abgesenkt haben.
Kiwis reifen langsam
Die großfrüchtigen Kiwis gibt es nicht nur im Handel – man kann sie auch bei uns anbauen. Wer eine Pflanze von Actinidia deliciosa im Garten hat, lässt die Früchte möglichst lange an der Pflanze ausreifen, bevor er sie erntet. Erst wenn sie stärkeren Frösten ausgesetzt waren, was meist ab Ende Oktober der Fall ist, sollte man die Stiele dicht über der Beerenfrucht abschneiden, um sie dann noch drei bis vier Wochen bei etwa 5 °C zu lagern. Dadurch werden sie zuletzt optimal für den Verzehr – weich und süß, wie man sie im Supermarkt nur selten findet.
Pflege der Wurzelscheiben
Auf den Rasenflächen darf das abgefallene Laub nicht über Winter liegenbleiben, weil darunter Fäulnis entstehen kann. Deshalb wird es nach Möglichkeit vor dem Schneefall nochmal abgerecht. Dagegen sind die Blätter auf den offenen Wurzelscheiben der Baum- und Beerenobst-Gehölze willkommen, denn unter dieser schützenden Abdeckung haben es die Wurzeln etwas wärmer. Besonders Himbeeren und Brombeeren sind für eine solche Mulchschicht während der Wintermonate dankbar. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass kein krankheitsbelastetes Laub (Schorf!) verwendet wird. Und bei Wühlmausalarm sollte man besser die nähere Umgebung der Baumstämme freihalten, denn die Nager würden sich unter dieser Decke besonders wohl fühlen. Wenn man die Fläche vor dem Mulchen noch flach lockert und mit gut ausgereiftem Kompost versorgt (nicht mit jungem, triebigem), gehen die Obstgehölze optimal versorgt in die nächste Saison.
Beerige Äpfelchen aus Kanada
Wer gerne Wildfrüchte nascht, der weiß wahrscheinlich schon, dass Felsenbirnen essbar sind und lecker schmecken. Nur Wenigen dürfte jedoch bekannt sein, dass die Erlenblättrige Felsenbirne (Amelanchier alnifolia, Bild: Sorte Northline), auch als Kanadische Blaubeere oder Saskatoon bezeichnet, schon bei den Indianern eine beliebte Wildfrucht war und heute sogar in Plantagen angebaut wird. Ihre süßen Früchte, die zudem sehr gesund sind, stehen in Trauben von jeweils etwa 10 Stück und erinnern im Geschmack an eine Mischung aus Heidelbeere, Mandel und Kirsche. Botanisch handelt es sich genau genommen um kleine Äpfelchen. Sie werden gerne zu Marmelade oder Beilagen verarbeitet, ähnlich wie Preiselbeeren.
Der robuste, selbstfruchtbare Strauch wird bis 4 m hoch und sieht mit seiner Blüte im Mai, den Früchten und zuletzt einer spektakulären Herbstfärbung auch recht hübsch aus. Die Wildart breitet sich mit Hilfe ihrer Ausläufer meist stärker aus, als das im Garten lieb sein kann. Eine eher schwach wachsende Sorte, die nur 2–2,50 m hoch wird, ist ‚Sleyt’.
Dahlien einwintern
Da Dahlien an den spätherbstlichen Tagen oft noch ganz schöne Bilder abgeben, kann man sie im Beet lassen, bis erste leichte Nachtfröste die Laubtriebe welken und letztlich absterben lassen. Bis dahin kann man sogar noch die eine oder andere Blüten für die Vase schneiden.
Der Frost darf allerdings nicht so stark sein, dass er in den Boden dringt und die Knollen schädigt. Man gräbt sie daher rechtzeitig vorher aus, am besten an einem sonnigen Tag im November, und schneidet die Stängel bis auf eine Handbreit zurück. Je trockener der Boden ist, desto leichter lassen sich große Erdbrocken abschütteln. Dann legt man sie in eine Kiste mit sandigem Substrat und bringt sie in einem luftigen und kühlen, aber frostfreien Raum vor stär keren Frösten in Sicherheit. Hier sollten die Dahlien knollen leicht feucht gehalten werden; ebenso wie die Rhizome des Indischen Blumenrohrs dürfen sie nicht völlig austrocknen. Die Zwiebeln von Gladiolen und Montbretien dagegen müssen vor dem Überwintern abtrocknen.
Unterwegs zum Schnecken-Quickie
Auf den ersten Blick könnte es eine kleine Schlange oder ein besonders langer und dicker roter Wurm sein. Beim zweiten dann entpuppt sich das Getier, das da im Schneckentempo den Weg quert, als zwei Nacktschnecken – die hintere direkt mit ihren Geruchsfühlern auf Tuchfühlung mit dem Körperende der vorderen, und auch die oberen Fühler mit den Augen starr auf selbiges gerichtet.